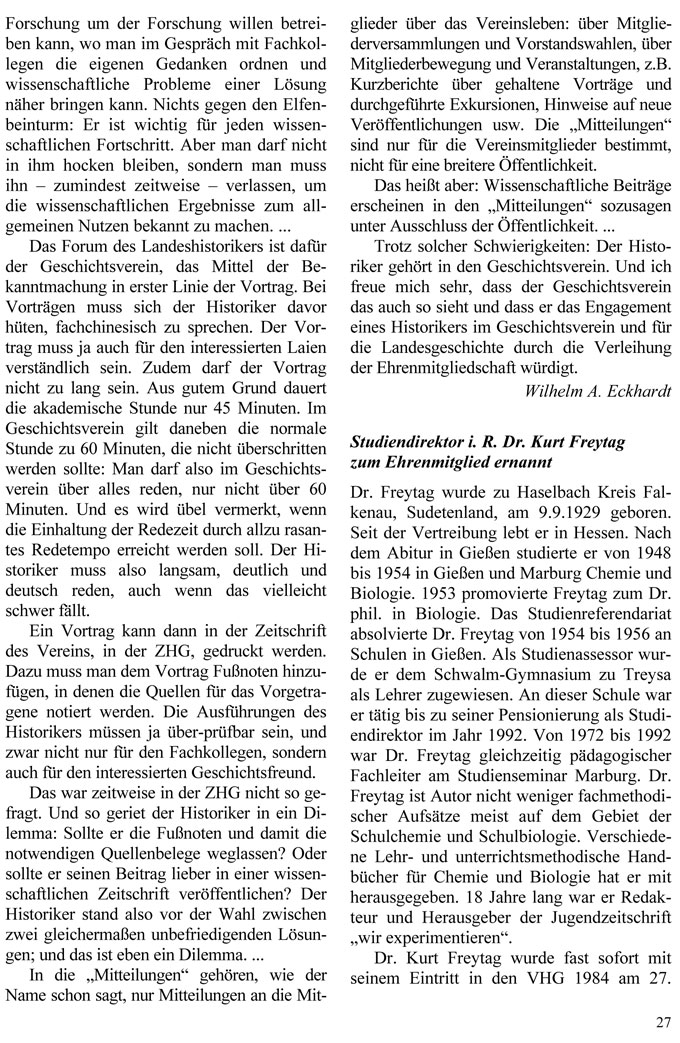 |
Forschung um der Forschung willen betreiben kann, wo man im Gespräch mit Fachkollegen die eigenen Gedanken ordnen und wissenschaftliche Probleme einer Lösung näher bringen kann. Nichts gegen den Elfenbeinturm: Er ist wichtig für jeden wissenschaftlichen Fortschritt. Aber man darf nicht in ihm hocken bleiben, sondern man muss ihn – zumindest zeitweise – verlassen, um die wissenschaftlichen Ergebnisse zum allgemeinen Nutzen bekannt zu machen. ...
Das Forum des Landeshistorikers ist dafür der Geschichtsverein, das Mittel der Bekanntmachung in erster Linie der Vortrag. Bei Vorträgen muss sich der Historiker davor hüten, fachchinesisch zu sprechen. Der Vortrag muss ja auch für den interessierten Laien verständlich sein. Zudem darf der Vortrag nicht zu lang sein. Aus gutem Grund dauert die akademische Stunde nur 45 Minuten. Im Geschichtsverein gilt daneben die normale Stunde zu 60 Minuten, die nicht überschritten werden sollte: Man darf also im Geschichtsverein über alles reden, nur nicht über 60 Minuten. Und es wird übel vermerkt, wenn die Einhaltung der Redezeit durch allzu rasantes Redetempo erreicht werden soll. Der Historiker muss also langsam, deutlich und deutsch reden, auch wenn das vielleicht schwer fällt.
Ein Vortrag kann dann in der Zeitschrift des Vereins, in der ZHG, gedruckt werden. Dazu muss man dem Vortrag Fußnoten hinzufügen, in denen die Quellen für das Vorgetragene notiert werden. Die Ausführungen des Historikers müssen ja über-prüfbar sein, und zwar nicht nur für den Fachkollegen, sondern auch für den interessierten Geschichtsfreund.
Das war zeitweise in der ZHG nicht so gefragt. Und so geriet der Historiker in ein Dilemma: Sollte er die Fußnoten und damit die notwendigen Quellenbelege weglassen? Oder sollte er seinen Beitrag lieber in einer wissenschaftlichen Zeitschrift veröffentlichen? Der Historiker stand also vor der Wahl zwischen zwei gleichermaßen unbefriedigenden Lösungen; und das ist eben ein Dilemma. ...
In die „Mitteilungen“ gehören, wie der Name schon sagt, nur Mitteilungen an die Mitglieder über das Vereinsleben: über Mitgliederversammlungen und Vorstandswahlen, über Mitgliederbewegung und Veranstaltungen, z.B. Kurzberichte über gehaltene Vorträge und durchgeführte Exkursionen, Hinweise auf neue Veröffentlichungen usw. Die „Mitteilungen“ sind nur für die Vereinsmitglieder bestimmt, nicht für eine breitere Öffentlichkeit.
Das heißt aber: Wissenschaftliche Beiträge erscheinen in den „Mitteilungen“ sozusagen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. ...
Trotz solcher Schwierigkeiten: Der Historiker gehört in den Geschichtsverein. Und ich freue mich sehr, dass der Geschichtsverein das auch so sieht und dass er das Engagement eines Historikers im Geschichtsverein und für die Landesgeschichte durch die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft würdigt.
Wilhelm A. Eckhardt
Studiendirektor i. R. Dr. Kurt Freytag zum Ehrenmitglied ernannt
Dr. Freytag wurde zu Haselbach Kreis Falkenau, Sudetenland, am 9.9.1929 geboren. Seit der Vertreibung lebt er in Hessen. Nach dem Abitur in Gießen studierte er von 1948 bis 1954 in Gießen und Marburg Chemie und Biologie. 1953 promovierte Freytag zum Dr. phil. in Biologie. Das Studienreferendariat absolvierte Dr. Freytag von 1954 bis 1956 an Schulen in Gießen. Als Studienassessor wurde er dem Schwalm-Gymnasium zu Treysa als Lehrer zugewiesen. An dieser Schule war er tätig bis zu seiner Pensionierung als Studiendirektor im Jahr 1992. Von 1972 bis 1992 war Dr. Freytag gleichzeitig pädagogischer Fachleiter am Studienseminar Marburg. Dr. Freytag ist Autor nicht weniger fachmethodischer Aufsätze meist auf dem Gebiet der Schulchemie und Schulbiologie. Verschiedene Lehr- und unterrichtsmethodische Handbücher für Chemie und Biologie hat er mit herausgegeben. 18 Jahre lang war er Redakteur und Herausgeber der Jugendzeitschrift „wir experimentieren“.
Dr. Kurt Freytag wurde fast sofort mit seinem Eintritt in den VHG 1984 am 27.
|
|