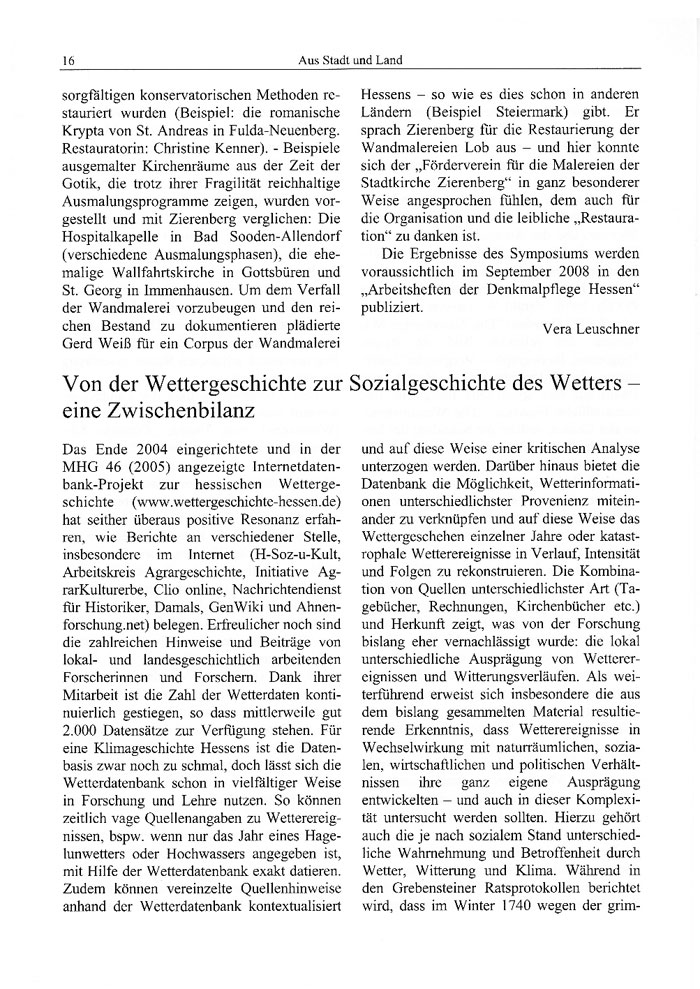16
Aus Stadt und Land
sorgfältigen konservatorischen Methoden restauriert wurden (Beispiel: die romanische Krypta von St. Andreas in Fulda-Neuenberg. Restauratorin: Christine Kenner). - Beispiele ausgemalter Kirchenräume aus der Zeit der Gotik, die trotz ihrer Fragilität reichhaltige Ausmalungsprogramme zeigen, wurden vorgestellt und mit Zierenberg verglichen: Die Hospitalkapelle in Bad Sooden-Allendorf (verschiedene Ausmalungsphasen), die ehemalige Wallfahrtskirche in Gottsbüren und St. Georg in Immenhausen. Um dem Verfall der Wandmalerei vorzubeugen und den reichen Bestand zu dokumentieren plädierte Gerd Weiß für ein Corpus der Wandmalerei
Hessens - so wie es dies schon in anderen Ländern (Beispiel Steiermark) gibt. Er sprach Zierenberg für die Restaurierung der Wandmalereien Lob aus - und hier konnte sich der „Förderverein für die Malereien der Stadtkirche Zierenberg" in ganz besonderer Weise angesprochen fühlen, dem auch für die Organisation und die leibliche „Restauration" zu danken ist.
Die Ergebnisse des Symposiums werden voraussichtlich im September 2008 in den „Arbeitsheften der Denkmalpflege Hessen" publiziert.
Vera Leuschner
Von der Wettergeschichte zur Sozialgeschichte des Wetters - eine Zwischenbilanz
Das Ende 2004 eingerichtete und in der MHG 46 (2005) angezeigte Internetdatenbank-Projekt zur hessischen Wettergeschichte (www.wettergeschichte-hessen.de) hat seither überaus positive Resonanz erfahren, wie Berichte an verschiedener Stelle, insbesondere im Internet (H-Soz-u-Kult, Arbeitskreis Agrargeschichte, Initiative AgrarKulturerbe, Clio online, Nachrichtendienst für Historiker, Damals, GenWiki und Ahnenforschung.net) belegen. Erfreulicher noch sind die zahlreichen Hinweise und Beiträge von lokal- und landesgeschichtlich arbeitenden Forscherinnen und Forschern. Dank ihrer Mitarbeit ist die Zahl der Wetterdaten kontinuierlich gestiegen, so dass mittlerweile gut 2.000 Datensätze zur Verfügung stehen. Für eine Klimageschichte Hessens ist die Datenbasis zwar noch zu schmal, doch lässt sich die Wetterdatenbank schon in vielfältiger Weise in Forschung und Lehre nutzen. So können zeitlich vage Quellenangaben zu Wetterereignissen, bspw. wenn nur das Jahr eines Hagelunwetters oder Hochwassers angegeben ist, mit Hilfe der Wetterdatenbank exakt datieren. Zudem können vereinzelte Quellenhinweise anhand der Wetterdatenbank kontextualisiert
und auf diese Weise einer kritischen Analyse unterzogen werden. Darüber hinaus bietet die Datenbank die Möglichkeit, Wetterinformationen unterschiedlichster Provenienz miteinander zu verknüpfen und auf diese Weise das Wettergeschehen einzelner Jahre oder katastrophale Wetterereignisse in Verlauf, Intensität und Folgen zu rekonstruieren. Die Kombination von Quellen unterschiedlichster Art (Tagebücher, Rechnungen, Kirchenbücher etc.) und Herkunft zeigt, was von der Forschung bislang eher vernachlässigt wurde: die lokal unterschiedliche Ausprägung von Wetterereignissen und Witterungsverläufen. Als weiterführend erweist sich insbesondere die aus dem bislang gesammelten Material resultierende Erkenntnis, dass Wetterereignisse in Wechselwirkung mit naturräumlichen, sozialen, wirtschaftlichen und politischen Verhältnissen ihre ganz eigene Ausprägung entwickelten - und auch in dieser Komplexität untersucht werden sollten. Hierzu gehört auch die je nach sozialem Stand unterschiedliche Wahrnehmung und Betroffenheit durch Wetter, Witterung und Klima. Während in den Grebensteiner Ratsprotokollen berichtet wird, dass im Winter 1740 wegen der grim-