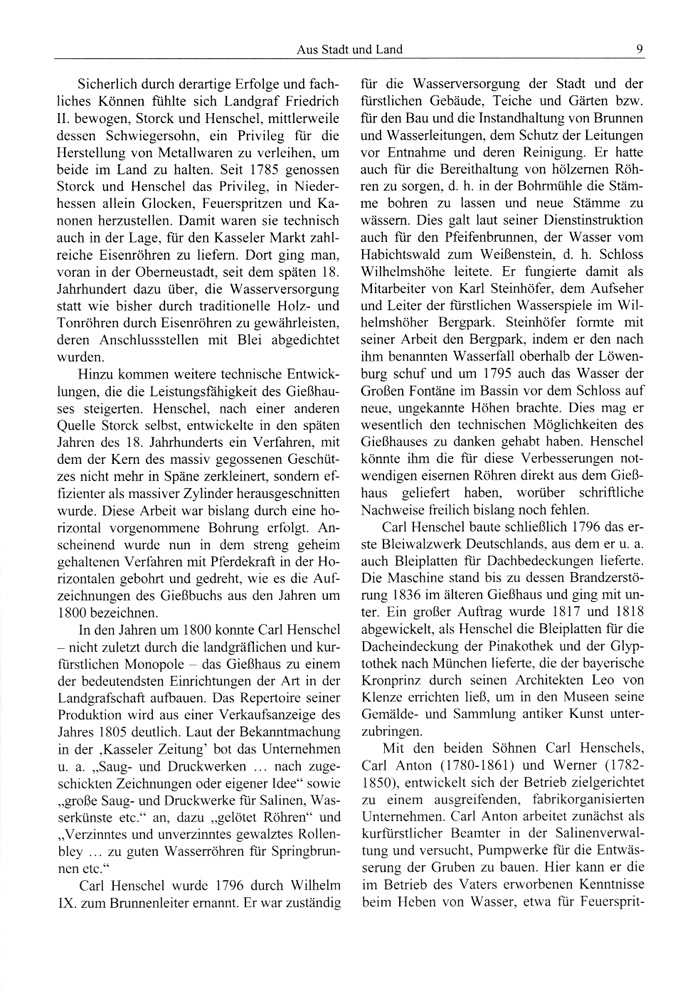Sicherlich durch derartige Erfolge und fachliches Können fühlte sich Landgraf Friedrich 11. bewogen, Storck und Henschel, mittlerweile dessen Schwiegersohn, ein Privileg für die Herstellung von Metallwaren zu verleihen, um beide im Land zu halten. Seit 1785 genossen Storck und Henschel das Privileg, in Niederhessen allein Glocken, Feuerspritzen und Kanonen herzustellen. Damit waren sie technisch auch in der Lage, für den Kasseler Markt zahlreiche Eisenröhren zu liefern. Dort ging man, voran in der Oberneustadt, seit dem späten 18. Jahrhundert dazu über, die Wasserversorgung statt wie bisher durch traditionelle Holz- und Tonröhren durch Eisenröhren zu gewährleisten, deren Anschlussstellen mit Blei abgedichtet wurden.
Hinzu kommen weitere technische Entwicklungen, die die Leistungsfähigkeit des Gießhauses steigerten. Henschel, nach einer anderen Quelle Storck selbst, entwickelte in den späten Jahren des 18. Jahrhunderts ein Verfahren, mit dem der Kern des massiv gegossenen Geschützes nicht mehr in Späne zerkleinert, sondern effizienter als massiver Zylinder herausgeschnitten wurde. Diese Arbeit war bislang durch eine horizontal vorgenommene Bohrung erfolgt. Anscheinend wurde nun in dem streng geheim gehaltenen Verfahren mit Pferdekraft in der Horizontalen gebohrt und gedreht, wie es die Aufzeichnungen des Gießbuchs aus den Jahren um 1800 bezeichnen.
In den Jahren um 1800 konnte Carl Henschel - nicht zuletzt durch die landgräflichen und kurfürstlichen Monopole - das Gießhaus zu einem der bedeutendsten Einrichtungen der Art in der Landgrafschaft aufbauen. Das Repertoire seiner Produktion wird aus einer Verkaufsanzeige des Jahres 1805 deutlich. Laut der Bekanntmachung in der Kasseler Zeitung' bot das Unternehmen u. a. „Saug- und Druckwerken ... nach zugeschickten Zeichnungen oder eigener Idee" sowie „große Saug- und Druckwerke für Salinen, Wasserkünste etc." an, dazu „gelötet Röhren" und „Verzinntes und unverzinntes gewalztes Rollenbley ... zu guten Wasserröhren für Springbrunnen etc."
Carl Henschel wurde 1796 durch Wilhelm IX. zum Brunnenleiter ernannt. Er war zuständig
für die Wasserversorgung der Stadt und der fürstlichen Gebäude, Teiche und Gärten bzw. für den Bau und die Instandhaltung von Brunnen und Wasserleitungen, dem Schutz der Leitungen vor Entnahme und deren Reinigung. Er hatte auch für die Bereithaltung von hölzernen Röhren zu sorgen, d. h. in der Bohrmühle die Stämme bohren zu lassen und neue Stämme zu wässern. Dies galt laut seiner Dienstinstruktion auch für den Pfeifenbrunnen, der Wasser vom Habichtswald zum Weißenstein, d. h. Schloss Wilhelmshöhe leitete. Er fungierte damit als Mitarbeiter von Karl Steinhöfer, dem Aufseher und Leiter der fürstlichen Wasserspiele im Wilhelmshöher Bergpark. Steinhöfer fonnte mit seiner Arbeit den Bergpark, indem er den nach ihm benannten Wasserfall oberhalb der Löwenburg schuf und um 1795 auch das Wasser der Großen Fontäne im Bassin vor dem Schloss auf neue, ungekannte Höhen brachte. Dies mag er wesentlich den technischen Möglichkeiten des Gießhauses zu danken gehabt haben. Henschel könnte ihm die für diese Verbesserungen notwendigen eisernen Röhren direkt aus dem Gießhaus geliefert haben, worüber schriftliche Nachweise freilich bislang noch fehlen.
Carl Henschel baute schließlich 1796 das erste Bleiwalzwerk Deutschlands, aus dem er u. a. auch Bleiplatten für Dachbedeckungen lieferte. Die Maschine stand bis zu dessen Brandzerstörung 1836 im älteren Gießhaus und ging mit unter. Ein großer Auftrag wurde 1817 und 1818 abgewickelt, als Henschel die Bleiplatten für die Dacheindeckung der Pinakothek und der Glyptothek nach München lieferte, die der bayerische Kronprinz durch seinen Architekten Leo von Klenze errichten ließ, um in den Museen seine Gemälde- und Sammlung antiker Kunst unterzubringen.
Mit den beiden Söhnen Carl Henschels, Carl Anton (1780-1861) und Werner (17821850), entwickelt sich der Betrieb zielgerichtet zu einem ausgreifenden, fabrikorganisierten Unternehmen. Carl Anton arbeitet zunächst als kurfürstlicher Beamter in der Salinenverwaltung und versucht, Pumpwerke für die Entwässerung der Gruben zu bauen. Hier kann er die im Betrieb des Vaters erworbenen Kenntnisse beim Heben von Wasser, etwa für Feuersprit-