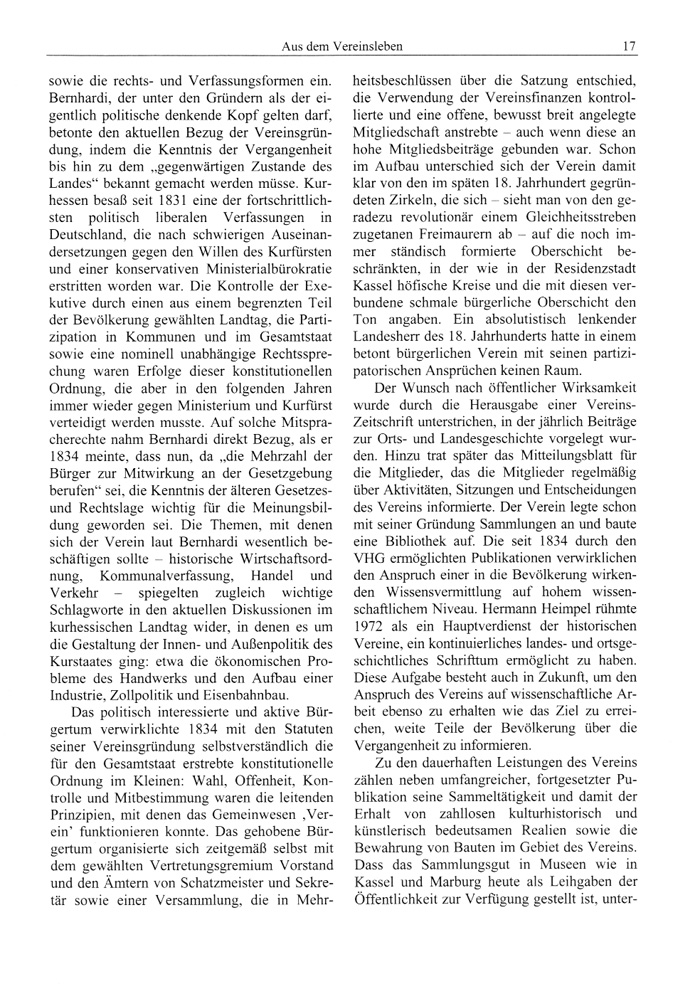sowie die rechts- und Verfassungsformen ein. Bernhardi, der unter den Gründern als der eigentlich politische denkende Kopf gelten darf, betonte den aktuellen Bezug der Vereinsgründung, indem die Kenntnis der Vergangenheit bis hin zu dem „gegenwärtigen Zustande des Landes" bekannt gemacht werden müsse. Kurhessen besaß seit 1831 eine der fortschrittlichsten politisch liberalen Verfassungen in Deutschland, die nach schwierigen Auseinandersetzungen gegen den Willen des Kurfürsten und einer konservativen Ministerialbürokratie erstritten worden war. Die Kontrolle der Exekutive durch einen aus einem begrenzten Teil der Bevölkerung gewählten Landtag, die Partizipation in Kommunen und im Gesamtstaat sowie eine nominell unabhängige Rechtssprechung waren Erfolge dieser konstitutionellen Ordnung, die aber in den folgenden Jahren immer wieder gegen Ministerium und Kurfürst verteidigt werden musste. Auf solche Mitspracherechte nahm Bernhardi direkt Bezug, als er 1834 meinte, dass nun, da „die Mehrzahl der Bürger zur Mitwirkung an der Gesetzgebung berufen" sei, die Kenntnis der älteren Gesetzesund Rechtslage wichtig für die Meinungsbildung geworden sei. Die Themen, mit denen sich der Verein laut Bernhardi wesentlich beschäftigen sollte - historische Wirtschaftsordnung, Kommunalverfassung, Handel und Verkehr - spiegelten zugleich wichtige Schlagworte in den aktuellen Diskussionen im kurhessischen Landtag wider, in denen es um die Gestaltung der Innen- und Außenpolitik des Kurstaates ging: etwa die ökonomischen Probleme des Handwerks und den Aufbau einer Industrie, Zollpolitik und Eisenbahnbau.
Das politisch interessierte und aktive Bürgertum verwirklichte 1834 mit den Statuten seiner Vereinsgründung selbstverständlich die für den Gesamtstaat erstrebte konstitutionelle Ordnung im Kleinen: Wahl, Offenheit, Kontrolle und Mitbestimmung waren die leitenden Prinzipien, mit denen das Gemeinwesen ,Verein' funktionieren konnte. Das gehobene Bürgertum organisierte sich zeitgemäß selbst mit dem gewählten Vertretungsgremium Vorstand und den Ämtern von Schatzmeister und Sekretär sowie einer Versammlung, die in Mehr
heitsbeschlüssen über die Satzung entschied, die Verwendung der Vereinsfinanzen kontrollierte und eine offene, bewusst breit angelegte Mitgliedschaft anstrebte - auch wenn diese an hohe Mitgliedsbeiträge gebunden war. Schon im Aufbau unterschied sich der Verein damit klar von den im späten 18. Jahrhundert gegründeten Zirkeln, die sich - sieht man von den geradezu revolutionär einem Gleichheitsstreben zugetanen Freimaurern ab - auf die noch immer ständisch formierte Oberschicht beschränkten, in der wie in der Residenzstadt Kassel höfische Kreise und die mit diesen verbundene schmale bürgerliche Oberschicht den Ton angaben. Ein absolutistisch lenkender Landesherr des 18. Jahrhunderts hatte in einem betont bürgerlichen Verein mit seinen partizipatorischen Ansprüchen keinen Raum.
Der Wunsch nach öffentlicher Wirksamkeit wurde durch die Herausgabe einer VereinsZeitschrift unterstrichen, in der jährlich Beiträge zur Orts- und Landesgeschichte vorgelegt wurden. Hinzu trat später das Mitteilungsblatt für die Mitglieder, das die Mitglieder regelmäßig über Aktivitäten, Sitzungen und Entscheidungen des Vereins informierte. Der Verein legte schon mit seiner Gründung Sammlungen an und baute eine Bibliothek auf. Die seit 1834 durch den VHG ermöglichten Publikationen verwirklichen den Anspruch einer in die Bevölkerung wirkenden Wissensvermittlung auf hohem wissenschaftlichem Niveau. Hermann Heimpel rühmte 1972 als ein Hauptverdienst der historischen Vereine, ein kontinuierliches landes- und ortsgeschichtliches Schrifttum ermöglicht zu haben. Diese Aufgabe besteht auch in Zukunft, um den Anspruch des Vereins auf wissenschaftliche Arbeit ebenso zu erhalten wie das Ziel zu erreichen, weite Teile der Bevölkerung über die Vergangenheit zu informieren.
Zu den dauerhaften Leistungen des Vereins zählen neben umfangreicher, fortgesetzter Publikation seine Sammeltätigkeit und damit der Erhalt von zahllosen kulturhistorisch und künstlerisch bedeutsamen Realien sowie die Bewahrung von Bauten im Gebiet des Vereins. Dass das Sammlungsgut in Museen wie in Kassel und Marburg heute als Leihgaben der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt ist, unter-