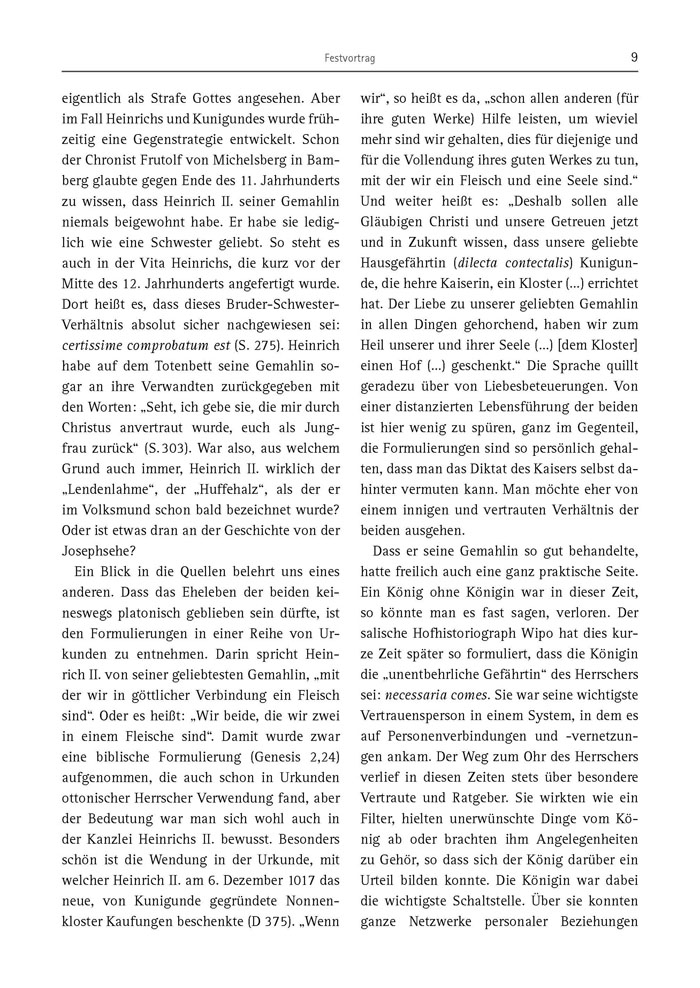eigentlich als Strafe Gottes angesehen. Aber im Fall Heinrichs und Kunigundes wurde frühzeitig eine Gegenstrategie entwickelt. Schon der Chronist Frutolf von Michelsberg in Bamberg glaubte gegen Ende des 11. Jahrhunderts zu wissen, dass Heinrich II. seiner Gemahlin niemals beigewohnt habe. Er habe sie lediglich wie eine Schwester geliebt. So steht es auch in der Vita Heinrichs, die kurz vor der Mitte des 12. Jahrhunderts angefertigt wurde. Dort heißt es, dass dieses Bruder-Schwester-Verhältnis absolut sicher nachgewiesen sei: certissime comprobatum est (S. 275). Heinrich habe auf dem Totenbett seine Gemahlin sogar an ihre Verwandten zurückgegeben mit den Worten: „Seht, ich gebe sie, die mir durch Christus anvertraut wurde, euch als Jungfrau zurück“ (S. 303). War also, aus welchem Grund auch immer, Heinrich II. wirklich der „Lendenlahme“, der „Huffehalz“, als der er im Volksmund schon bald bezeichnet wurde? Oder ist etwas dran an der Geschichte von der Josephsehe?
Ein Blick in die Quellen belehrt uns eines anderen. Dass das Eheleben der beiden keineswegs platonisch geblieben sein dürfte, ist den Formulierungen in einer Reihe von Urkunden zu entnehmen. Darin spricht Heinrich II. von seiner geliebtesten Gemahlin, „mit der wir in göttlicher Verbindung ein Fleisch sind“. Oder es heißt: „Wir beide, die wir zwei in einem Fleische sind“. Damit wurde zwar eine biblische Formulierung (Genesis 2,24) aufgenommen, die auch schon in Urkunden ottonischer Herrscher Verwendung fand, aber der Bedeutung war man sich wohl auch in der Kanzlei Heinrichs II. bewusst. Besonders schön ist die Wendung in der Urkunde, mit welcher Heinrich II. am 6. Dezember 1017 das neue, von Kunigunde gegründete Nonnenkloster Kaufungen beschenkte (D 375). „Wenn wir“, so heißt es da, „schon allen anderen (für ihre guten Werke) Hilfe leisten, um wieviel mehr sind wir gehalten, dies für diejenige und für die Vollendung ihres guten Werkes zu tun, mit der wir ein Fleisch und eine Seele sind.“ Und weiter heißt es: „Deshalb sollen alle Gläubigen Christi und unsere Getreuen jetzt und in Zukunft wissen, dass unsere geliebte Hausgefährtin (dilecta contectalis) Kunigunde, die hehre Kaiserin, ein Kloster (...) errichtet hat. Der Liebe zu unserer geliebten Gemahlin in allen Dingen gehorchend, haben wir zum Heil unserer und ihrer Seele (...) [dem Kloster] einen Hof (...) geschenkt.“ Die Sprache quillt geradezu über von Liebesbeteuerungen. Von einer distanzierten Lebensführung der beiden ist hier wenig zu spüren, ganz im Gegenteil, die Formulierungen sind so persönlich gehalten, dass man das Diktat des Kaisers selbst dahinter vermuten kann. Man möchte eher von einem innigen und vertrauten Verhältnis der beiden ausgehen.
Dass er seine Gemahlin so gut behandelte, hatte freilich auch eine ganz praktische Seite. Ein König ohne Königin war in dieser Zeit, so könnte man es fast sagen, verloren. Der salische Hofhistoriograph Wipo hat dies kurze Zeit später so formuliert, dass die Königin die „unentbehrliche Gefährtin“ des Herrschers sei: necessaria comes. Sie war seine wichtigste Vertrauensperson in einem System, in dem es auf Personenverbindungen und -vernetzungen ankam. Der Weg zum Ohr des Herrschers verlief in diesen Zeiten stets über besondere Vertraute und Ratgeber. Sie wirkten wie ein Filter, hielten unerwünschte Dinge vom König ab oder brachten ihm Angelegenheiten zu Gehör, so dass sich der König darüber ein Urteil bilden konnte. Die Königin war dabei die wichtigste Schaltstelle. Über sie konnten ganze Netzwerke personaler Beziehungen