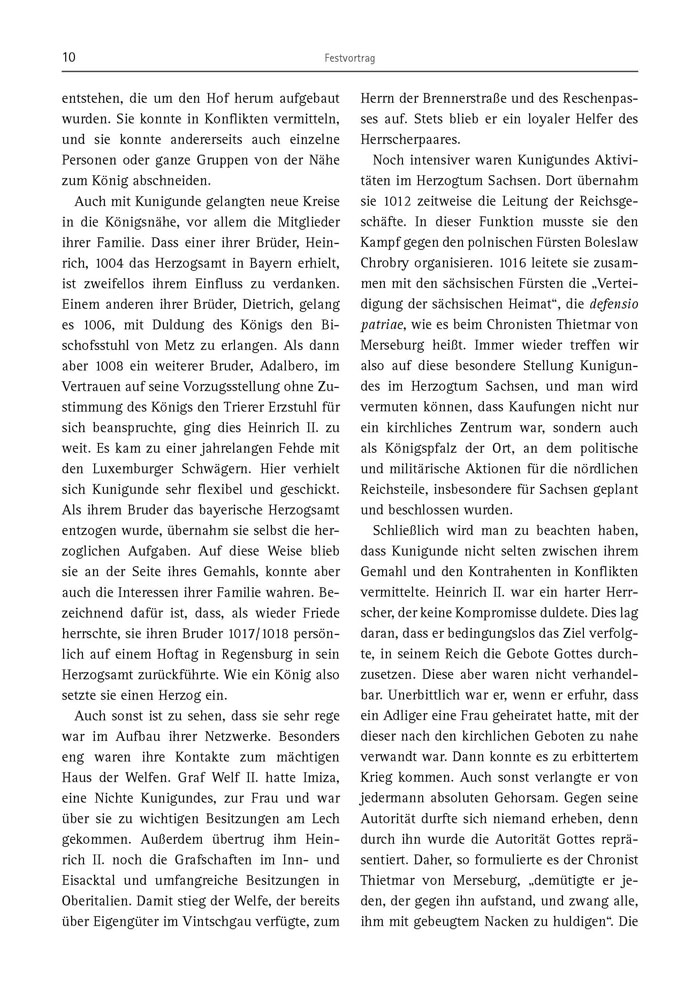entstehen, die um den Hof herum aufgebaut wurden. Sie konnte in Konflikten vermitteln, und sie konnte andererseits auch einzelne Personen oder ganze Gruppen von der Nähe zum König abschneiden.
Auch mit Kunigunde gelangten neue Kreise in die Königsnähe, vor allem die Mitglieder ihrer Familie. Dass einer ihrer Brüder, Heinrich, 1004 das Herzogsamt in Bayern erhielt, ist zweifellos ihrem Einfluss zu verdanken. Einem anderen ihrer Brüder, Dietrich, gelang es 1006, mit Duldung des Königs den Bischofsstuhl von Metz zu erlangen. Als dann aber 1008 ein weiterer Bruder, Adalbero, im Vertrauen auf seine Vorzugsstellung ohne Zustimmung des Königs den Trierer Erzstuhl für sich beanspruchte, ging dies Heinrich II. zu weit. Es kam zu einer jahrelangen Fehde mit den Luxemburger Schwägern. Hier verhielt sich Kunigunde sehr flexibel und geschickt. Als ihrem Bruder das bayerische Herzogsamt entzogen wurde, übernahm sie selbst die herzoglichen Aufgaben. Auf diese Weise blieb sie an der Seite ihres Gemahls, konnte aber auch die Interessen ihrer Familie wahren. Bezeichnend dafür ist, dass, als wieder Friede herrschte, sie ihren Bruder 1017/1018 persönlich auf einem Hoftag in Regensburg in sein Herzogsamt zurückführte. Wie ein König also setzte sie einen Herzog ein.
Auch sonst ist zu sehen, dass sie sehr rege war im Aufbau ihrer Netzwerke. Besonders eng waren ihre Kontakte zum mächtigen Haus der Welfen. Graf Welf II. hatte Imiza, eine Nichte Kunigundes, zur Frau und war über sie zu wichtigen Besitzungen am Lech gekommen. Außerdem übertrug ihm Heinrich II. noch die Grafschaften im Inn- und Eisacktal und umfangreiche Besitzungen in Oberitalien. Damit stieg der Welfe, der bereits über Eigengüter im Vintschgau verfügte, zum Herrn der Brennerstraße und des Reschenpasses auf. Stets blieb er ein loyaler Helfer des Herrscherpaares.
Noch intensiver waren Kunigundes Aktivitäten im Herzogtum Sachsen. Dort übernahm sie 1012 zeitweise die Leitung der Reichsgeschäfte. In dieser Funktion musste sie den Kampf gegen den polnischen Fürsten Boleslaw Chrobry organisieren. 1016 leitete sie zusammen mit den sächsischen Fürsten die „Verteidigung der sächsischen Heimat“, die defensio patriae, wie es beim Chronisten Thietmar von Merseburg heißt. Immer wieder treffen wir also auf diese besondere Stellung Kunigundes im Herzogtum Sachsen, und man wird vermuten können, dass Kaufungen nicht nur ein kirchliches Zentrum war, sondern auch als Königspfalz der Ort, an dem politische und militärische Aktionen für die nördlichen Reichsteile, insbesondere für Sachsen geplant und beschlossen wurden.
Schließlich wird man zu beachten haben, dass Kunigunde nicht selten zwischen ihrem Gemahl und den Kontrahenten in Konflikten vermittelte. Heinrich II. war ein harter Herrscher, der keine Kompromisse duldete. Dies lag daran, dass er bedingungslos das Ziel verfolgte, in seinem Reich die Gebote Gottes durchzusetzen. Diese aber waren nicht verhandelbar. Unerbittlich war er, wenn er erfuhr, dass ein Adliger eine Frau geheiratet hatte, mit der dieser nach den kirchlichen Geboten zu nahe verwandt war. Dann konnte es zu erbittertem Krieg kommen. Auch sonst verlangte er von jedermann absoluten Gehorsam. Gegen seine Autorität durfte sich niemand erheben, denn durch ihn wurde die Autorität Gottes repräsentiert. Daher, so formulierte es der Chronist Thietmar von Merseburg, „demütigte er jeden, der gegen ihn aufstand, und zwang alle, ihm mit gebeugtem Nacken zu huldigen“. Die