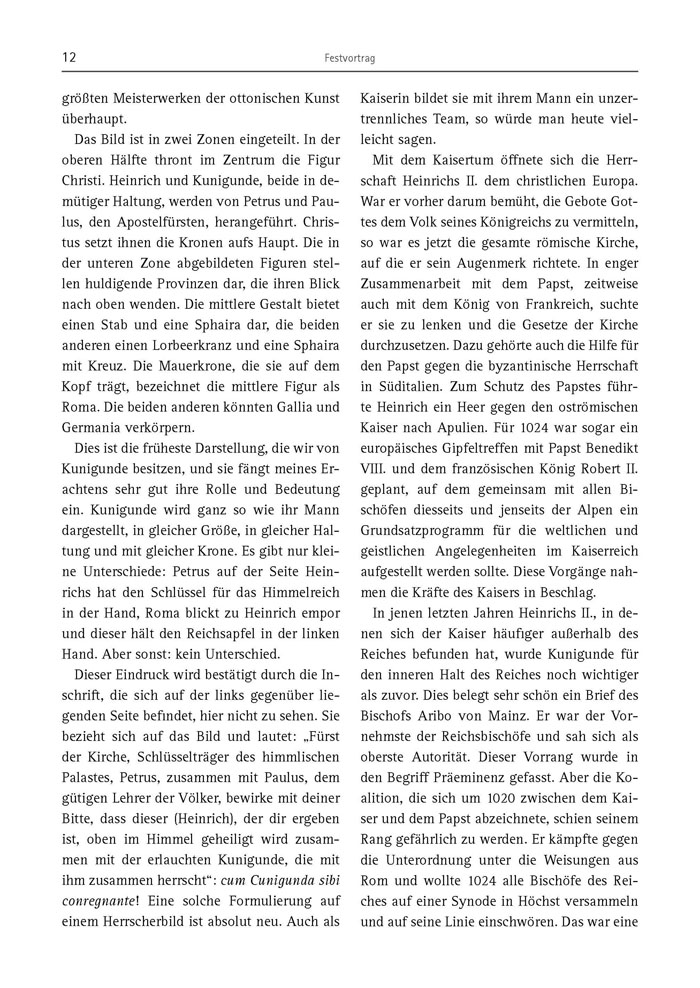größten Meisterwerken der ottonischen Kunst überhaupt.
Das Bild ist in zwei Zonen eingeteilt. In der oberen Hälfte thront im Zentrum die Figur Christi. Heinrich und Kunigunde, beide in demütiger Haltung, werden von Petrus und Paulus, den Apostelfürsten, herangeführt. Christus setzt ihnen die Kronen aufs Haupt. Die in der unteren Zone abgebildeten Figuren stellen huldigende Provinzen dar, die ihren Blick nach oben wenden. Die mittlere Gestalt bietet einen Stab und eine Sphaira dar, die beiden anderen einen Lorbeerkranz und eine Sphaira mit Kreuz. Die Mauerkrone, die sie auf dem Kopf trägt, bezeichnet die mittlere Figur als Roma. Die beiden anderen könnten Gallia und Germania verkörpern.
Dies ist die früheste Darstellung, die wir von Kunigunde besitzen, und sie fängt meines Erachtens sehr gut ihre Rolle und Bedeutung ein. Kunigunde wird ganz so wie ihr Mann dargestellt, in gleicher Größe, in gleicher Haltung und mit gleicher Krone. Es gibt nur kleine Unterschiede: Petrus auf der Seite Heinrichs hat den Schlüssel für das Himmelreich in der Hand, Roma blickt zu Heinrich empor und dieser hält den Reichsapfel in der linken Hand. Aber sonst: kein Unterschied.
Dieser Eindruck wird bestätigt durch die Inschrift, die sich auf der links gegenüber liegenden Seite befindet, hier nicht zu sehen. Sie bezieht sich auf das Bild und lautet: „Fürst der Kirche, Schlüsselträger des himmlischen Palastes, Petrus, zusammen mit Paulus, dem gütigen Lehrer der Völker, bewirke mit deiner Bitte, dass dieser (Heinrich), der dir ergeben ist, oben im Himmel geheiligt wird zusammen mit der erlauchten Kunigunde, die mit ihm zusammen herrscht“: cum Cunigunda sibi conregnante! Eine solche Formulierung auf einem Herrscherbild ist absolut neu. Auch als Kaiserin bildet sie mit ihrem Mann ein unzertrennliches Team, so würde man heute vielleicht sagen.
Mit dem Kaisertum öffnete sich die Herrschaft Heinrichs II. dem christlichen Europa. War er vorher darum bemüht, die Gebote Gottes dem Volk seines Königreichs zu vermitteln, so war es jetzt die gesamte römische Kirche, auf die er sein Augenmerk richtete. In enger Zusammenarbeit mit dem Papst, zeitweise auch mit dem König von Frankreich, suchte er sie zu lenken und die Gesetze der Kirche durchzusetzen. Dazu gehörte auch die Hilfe für den Papst gegen die byzantinische Herrschaft in Süditalien. Zum Schutz des Papstes führte Heinrich ein Heer gegen den oströmischen Kaiser nach Apulien. Für 1024 war sogar ein europäisches Gipfeltreffen mit Papst Benedikt VIII. und dem französischen König Robert II. geplant, auf dem gemeinsam mit allen Bischöfen diesseits und jenseits der Alpen ein Grundsatzprogramm für die weltlichen und geistlichen Angelegenheiten im Kaiserreich aufgestellt werden sollte. Diese Vorgänge nahmen die Kräfte des Kaisers in Beschlag.
In jenen letzten Jahren Heinrichs II., in denen sich der Kaiser häufiger außerhalb des Reiches befunden hat, wurde Kunigunde für den inneren Halt des Reiches noch wichtiger als zuvor. Dies belegt sehr schön ein Brief des Bischofs Aribo von Mainz. Er war der Vornehmste der Reichsbischöfe und sah sich als oberste Autorität. Dieser Vorrang wurde in den Begriff Präeminenz gefasst. Aber die Koalition, die sich um 1020 zwischen dem Kaiser und dem Papst abzeichnete, schien seinem Rang gefährlich zu werden. Er kämpfte gegen die Unterordnung unter die Weisungen aus Rom und wollte 1024 alle Bischöfe des Reiches auf einer Synode in Höchst versammeln und auf seine Linie einschwören. Das war eine