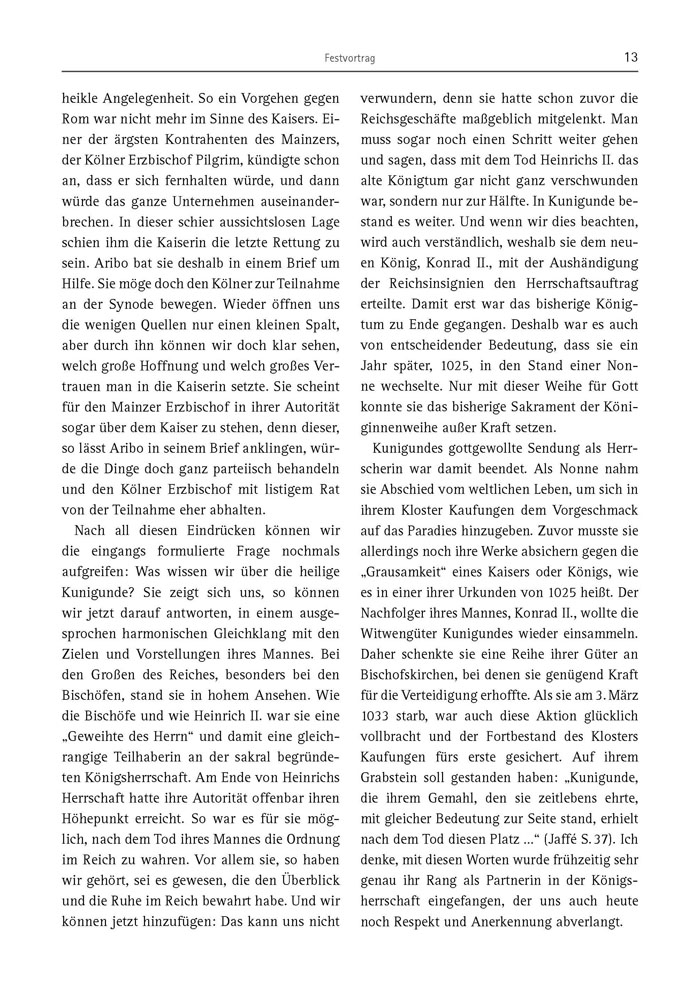heikle Angelegenheit. So ein Vorgehen gegen Rom war nicht mehr im Sinne des Kaisers. Einer der ärgsten Kontrahenten des Mainzers, der Kölner Erzbischof Pilgrim, kündigte schon an, dass er sich fernhalten würde, und dann würde das ganze Unternehmen auseinanderbrechen. In dieser schier aussichtslosen Lage schien ihm die Kaiserin die letzte Rettung zu sein. Aribo bat sie deshalb in einem Brief um Hilfe. Sie möge doch den Kölner zur Teilnahme an der Synode bewegen. Wieder öffnen uns die wenigen Quellen nur einen kleinen Spalt, aber durch ihn können wir doch klar sehen, welch große Hoffnung und welch großes Vertrauen man in die Kaiserin setzte. Sie scheint für den Mainzer Erzbischof in ihrer Autorität sogar über dem Kaiser zu stehen, denn dieser, so lässt Aribo in seinem Brief anklingen, würde die Dinge doch ganz parteiisch behandeln und den Kölner Erzbischof mit listigem Rat von der Teilnahme eher abhalten.
Nach all diesen Eindrücken können wir die eingangs formulierte Frage nochmals aufgreifen: Was wissen wir über die heilige Kunigunde? Sie zeigt sich uns, so können wir jetzt darauf antworten, in einem ausgesprochen harmonischen Gleichklang mit den Zielen und Vorstellungen ihres Mannes. Bei den Großen des Reiches, besonders bei den Bischöfen, stand sie in hohem Ansehen. Wie die Bischöfe und wie Heinrich II. war sie eine „Geweihte des Herrn“ und damit eine gleichrangige Teilhaberin an der sakral begründeten Königsherrschaft. Am Ende von Heinrichs Herrschaft hatte ihre Autorität offenbar ihren Höhepunkt erreicht. So war es für sie möglich, nach dem Tod ihres Mannes die Ordnung im Reich zu wahren. Vor allem sie, so haben wir gehört, sei es gewesen, die den Überblick und die Ruhe im Reich bewahrt habe. Und wir können jetzt hinzufügen: Das kann uns nicht verwundern, denn sie hatte schon zuvor die Reichsgeschäfte maßgeblich mitgelenkt. Man muss sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, dass mit dem Tod Heinrichs II. das alte Königtum gar nicht ganz verschwunden war, sondern nur zur Hälfte. In Kunigunde bestand es weiter. Und wenn wir dies beachten, wird auch verständlich, weshalb sie dem neuen König, Konrad II., mit der Aushändigung der Reichsinsignien den Herrschaftsauftrag erteilte. Damit erst war das bisherige Königtum zu Ende gegangen. Deshalb war es auch von entscheidender Bedeutung, dass sie ein Jahr später, 1025, in den Stand einer Nonne wechselte. Nur mit dieser Weihe für Gott konnte sie das bisherige Sakrament der Königinnenweihe außer Kraft setzen.
Kunigundes gottgewollte Sendung als Herrscherin war damit beendet. Als Nonne nahm sie Abschied vom weltlichen Leben, um sich in ihrem Kloster Kaufungen dem Vorgeschmack auf das Paradies hinzugeben. Zuvor musste sie allerdings noch ihre Werke absichern gegen die „Grausamkeit“ eines Kaisers oder Königs, wie es in einer ihrer Urkunden von 1025 heißt. Der Nachfolger ihres Mannes, Konrad II., wollte die Witwengüter Kunigundes wieder einsammeln. Daher schenkte sie eine Reihe ihrer Güter an Bischofskirchen, bei denen sie genügend Kraft für die Verteidigung erhoffte. Als sie am 3. März 1033 starb, war auch diese Aktion glücklich vollbracht und der Fortbestand des Klosters Kaufungen fürs erste gesichert. Auf ihrem Grabstein soll gestanden haben: „Kunigunde, die ihrem Gemahl, den sie zeitlebens ehrte, mit gleicher Bedeutung zur Seite stand, erhielt nach dem Tod diesen Platz …“ (Jaffé S. 37). Ich denke, mit diesen Worten wurde frühzeitig sehr genau ihr Rang als Partnerin in der Königsherrschaft eingefangen, der uns auch heute noch Respekt und Anerkennung abverlangt.