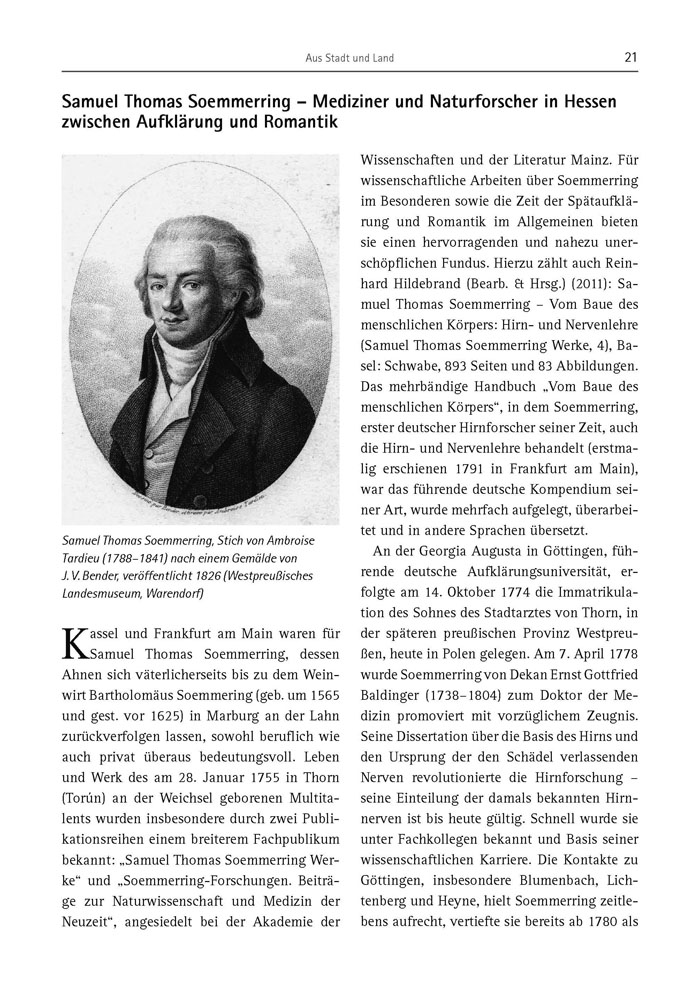 |
Samuel Thomas Soemmerring – Mediziner und Naturforscher in Hessen zwischen Aufklärung und Romantik
Kassel und Frankfurt am Main waren für Samuel Thomas Soemmerring, dessen Ahnen sich väterlicherseits bis zu dem Weinwirt Bartholomäus Soemmering (geb. um 1565 und gest. vor 1625) in Marburg an der Lahn zurückverfolgen lassen, sowohl beruflich wie auch privat überaus bedeutungsvoll. Leben und Werk des am 28. Januar 1755 in Thorn (Torún) an der Weichsel geborenen Multitalents wurden insbesondere durch zwei Publikationsreihen einem breiterem Fachpublikum bekannt: „Samuel Thomas Soemmerring Werke“ und „Soemmerring-Forschungen. Beiträge zur Naturwissenschaft und Medizin der Neuzeit“, angesiedelt bei der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz. Für wissenschaftliche Arbeiten über Soemmerring im Besonderen sowie die Zeit der Spätaufklärung und Romantik im Allgemeinen bieten sie einen hervorragenden und nahezu unerschöpflichen Fundus. Hierzu zählt auch Reinhard Hildebrand (Bearb. & Hrsg.) (2011): Samuel Thomas Soemmerring – Vom Baue des menschlichen Körpers: Hirn- und Nervenlehre (Samuel Thomas Soemmerring Werke, 4), Basel: Schwabe, 893 Seiten und 83 Abbildungen. Das mehrbändige Handbuch „Vom Baue des menschlichen Körpers“, in dem Soemmerring, erster deutscher Hirnforscher seiner Zeit, auch die Hirn- und Nervenlehre behandelt (erstmalig erschienen 1791 in Frankfurt am Main), war das führende deutsche Kompendium seiner Art, wurde mehrfach aufgelegt, überarbeitet und in andere Sprachen übersetzt.
An der Georgia Augusta in Göttingen, führende deutsche Aufklärungsuniversität, erfolgte am 14. Oktober 1774 die Immatrikulation des Sohnes des Stadtarztes von Thorn, in der späteren preußischen Provinz Westpreußen, heute in Polen gelegen. Am 7. April 1778 wurde Soemmerring von Dekan Ernst Gottfried Baldinger (1738–1804) zum Doktor der Medizin promoviert mit vorzüglichem Zeugnis. Seine Dissertation über die Basis des Hirns und den Ursprung der den Schädel verlassenden Nerven revolutionierte die Hirnforschung – seine Einteilung der damals bekannten Hirnnerven ist bis heute gültig. Schnell wurde sie unter Fachkollegen bekannt und Basis seiner wissenschaftlichen Karriere. Die Kontakte zu Göttingen, insbesondere Blumenbach, Lichtenberg und Heyne, hielt Soemmerring zeitlebens aufrecht, vertiefte sie bereits ab 1780 als
Samuel Thomas Soemmerring, Stich von Ambroise Tardieu (1788–1841) nach einem Gemälde von J. V. Bender, veröffentlicht 1826 (Westpreußisches Landesmuseum, Warendorf)
|
|
|
|