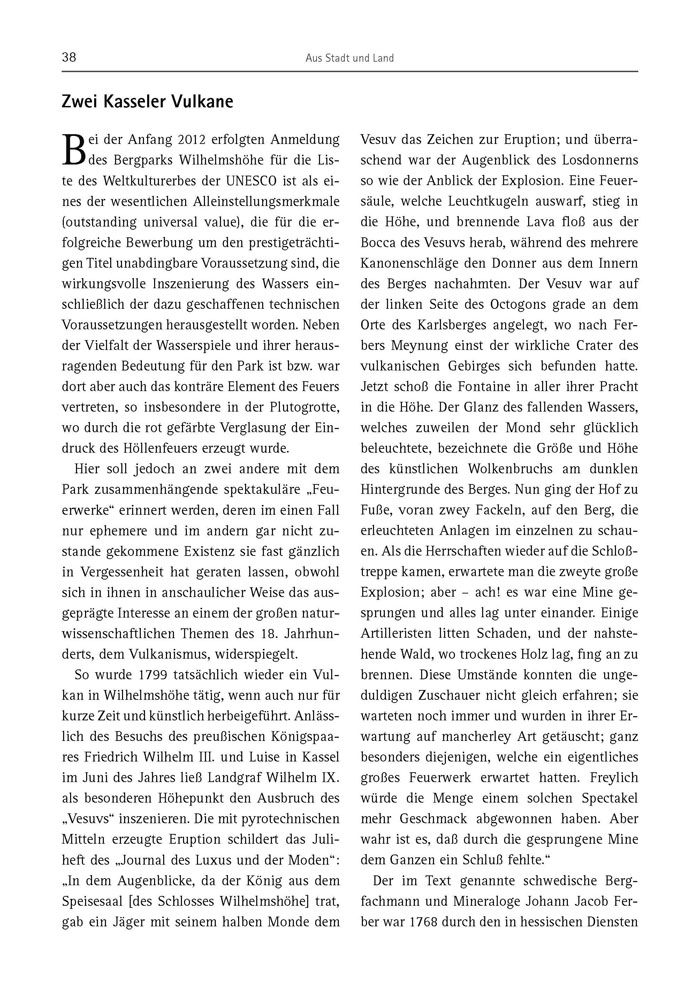 |
Zwei Kasseler Vulkane
Bei der Anfang 2012 erfolgten Anmeldung des Bergparks Wilhelmshöhe für die Liste des Weltkulturerbes der UNESCO ist als eines der wesentlichen Alleinstellungsmerkmale (outstanding universal value), die für die erfolgreiche Bewerbung um den prestigeträchtigen Titel unabdingbare Voraussetzung sind, die wirkungsvolle Inszenierung des Wassers einschließlich der dazu geschaffenen technischen Voraussetzungen herausgestellt worden. Neben der Vielfalt der Wasserspiele und ihrer herausragenden Bedeutung für den Park ist bzw. war dort aber auch das konträre Element des Feuers vertreten, so insbesondere in der Plutogrotte, wo durch die rot gefärbte Verglasung der Eindruck des Höllenfeuers erzeugt wurde.
Hier soll jedoch an zwei andere mit dem Park zusammenhängende spektakuläre „Feuerwerke“ erinnert werden, deren im einen Fall nur ephemere und im andern gar nicht zustande gekommene Existenz sie fast gänzlich in Vergessenheit hat geraten lassen, obwohl sich in ihnen in anschaulicher Weise das ausgeprägte Interesse an einem der großen naturwissenschaftlichen Themen des 18. Jahrhunderts, dem Vulkanismus, widerspiegelt.
So wurde 1799 tatsächlich wieder ein Vulkan in Wilhelmshöhe tätig, wenn auch nur für kurze Zeit und künstlich herbeigeführt. Anlässlich des Besuchs des preußischen Königspaares Friedrich Wilhelm III. und Luise in Kassel im Juni des Jahres ließ Landgraf Wilhelm IX. als besonderen Höhepunkt den Ausbruch des „Vesuvs“ inszenieren. Die mit pyrotechnischen Mitteln erzeugte Eruption schildert das Juliheft des „Journal des Luxus und der Moden“: „In dem Augenblicke, da der König aus dem Speisesaal [des Schlosses Wilhelmshöhe] trat, gab ein Jäger mit seinem halben Monde dem Vesuv das Zeichen zur Eruption; und überraschend war der Augenblick des Losdonnerns so wie der Anblick der Explosion. Eine Feuersäule, welche Leuchtkugeln auswarf, stieg in die Höhe, und brennende Lava floß aus der Bocca des Vesuvs herab, während des mehrere Kanonenschläge den Donner aus dem Innern des Berges nachahmten. Der Vesuv war auf der linken Seite des Octogons grade an dem Orte des Karlsberges angelegt, wo nach Ferbers Meynung einst der wirkliche Crater des vulkanischen Gebirges sich befunden hatte. Jetzt schoß die Fontaine in aller ihrer Pracht in die Höhe. Der Glanz des fallenden Wassers, welches zuweilen der Mond sehr glücklich beleuchtete, bezeichnete die Größe und Höhe des künstlichen Wolkenbruchs am dunklen Hintergrunde des Berges. Nun ging der Hof zu Fuße, voran zwey Fackeln, auf den Berg, die erleuchteten Anlagen im einzelnen zu schauen. Als die Herrschaften wieder auf die Schloßtreppe kamen, erwartete man die zweyte große Explosion; aber – ach! es war eine Mine gesprungen und alles lag unter einander. Einige Artilleristen litten Schaden, und der nahstehende Wald, wo trockenes Holz lag, fing an zu brennen. Diese Umstände konnten die ungeduldigen Zuschauer nicht gleich erfahren; sie warteten noch immer und wurden in ihrer Erwartung auf mancherley Art getäuscht; ganz besonders diejenigen, welche ein eigentliches großes Feuerwerk erwartet hatten. Freylich würde die Menge einem solchen Spectakel mehr Geschmack abgewonnen haben. Aber wahr ist es, daß durch die gesprungene Mine dem Ganzen ein Schluß fehlte.“
Der im Text genannte schwedische Bergfachmann und Mineraloge Johann Jacob Ferber war 1768 durch den in hessischen Diensten
|
|
|
|